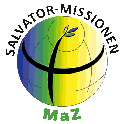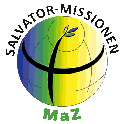| |
Am darauf folgenden Tag wurde ich im Kindergarten, meiner Arbeitsstelle, vorgestellt und wurde sofort ins kalte Wasser geworfen, da ich gleich eine Unterrichtseinheit allein hab übernehmen müssen/dürfen. In den Kindergarten kamen täglich zwischen 80 und 100
3-6-Jährige, die dann in drei Altersstufen unterteilt wurden. Ich war die Lehrerin für die Ältesten, die im darauf folgenden Jahr in die Grundschule wechselten. Im Kindergarten ist es nämlich so, dass nicht nur gespielt wird, sondern auch eine Stunde pro Tag richtig gelehrt und gelernt wird. Meine Aufgabe war es also auch, den Kindern lesen, schreiben, rechnen und ein bisschen Englisch beizubringen.
Zu Beginn meiner Arbeit im Kindergarten, stand ich vor einigen Problemen, die mir anfangs wirklich zu schaffen machten. Zunächst war da die Sprache, die Grundlagen waren zwar vorhanden, trotzdem konnte ich mich erstmal nur stammelnd unterhalten, und da war es auch gar nicht so einfach, die Kinder zu bändigen. Dass ich zunächst keine Autorität vor den Kindern hatte, lag aber nicht nur an der Sprache, sondern auch daran, dass sie sich nur ruhig verhielten, wenn der Stock zum Einsatz kam. Wenn es in der Klasse nämlich zu laut wurde, kam eine der Lehrerinnen und sorgte mit Stockschlägen für Ruhe. Da ich mich aber strikt weigerte, den Stock als Erziehungsmittel zu missbrauchen, hatte ich anfangs einen schweren Stand vor den Kindern. Doch mit der Zeit wurde mein Kiswahili besser und die Kinder fingen an mich zu mögen und zu respektieren und hatten auch Spaß am Unterricht. Und mir persönlich machte es nichts aus, wenn der Lärmpegel in der Klasse mal etwas höher war.
Zu Beginn musste ich trotzdem lernen, den Druck, den ich mir machte, wegzunehmen, meine eigenen Ansprüche herunterzuschrauben, zu begreifen, dass auch Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen in die Grundschule kommen. Als ich das kapiert hatte, wurde ich viel lockerer und das Unterrichten machte mir richtig Spaß. Da ich nicht nur die Lehrerin der Kinder war, sondern auch ihre Spiel- und Kuschelkameradin, wurde unser Verhältnis zunehmend inniger, die Kleinen wuchsen mir richtig ans Herz und der Abschied viel mir auch dementsprechend echt schwer. Es war so lieb zu sehen, wie die Kinder mir zum Abschied vorgesungen und –getanzt haben.
Doch es gab auch ein Leben neben dem Kindergarten. Denn dieser fand nur vormittags statt, das heißt um zwölf war für mich der Arbeitstag zu Ende. Nachmittags also ging ich meistens im Dorf spazieren, wo ich mit der Zeit auch Freunde fand, die mich immer wieder zu sich nach Hause einluden, mit denen ich auch mal Fahrradtouren in die Umgebung unternahm oder die mich mit auf eine Initiation nahmen. Mit der Köchin der Ordensschwestern, die sich zu einer Ersatzmama für mich entwickelt hat, bin ich auch ab und zu mit aufs Feld, um Mais, Reis, Erdnüsse oder anderes zu pflanzen und zu ernten. Für all diese Erfahrungen bin ich unendlich dankbar, weil ich so die afrikanische Kultur und das Leben der Einheimischen wirklich kennen lernen durfte. Und ich war immer wieder erstaunt über die Gastfreundschaft der Tansanier. Auch wenn sie in Lehmhütten wohnten und das, was sie zum Leben brauchten, auf ihrem Feld erwirtschafteten, wurde ich als Gast immer gern gesehen, mir wurde immer etwas zum Essen angeboten und meistens gaben sie mir auch etwas als Geschenk mit nach Hause. Ich war so beeindruckt davon, wie die Leute, die fast nichts hatten, trotzdem auch noch mit mir teilten.
Natürlich ergab sich auch so manches Problem aus meiner Stellung als einzige Mzungu (Weiße) in einem kleinen Dorf abseits aller Touristenströme. Ich war natürlich die Attraktion im Dorf, alle wollten ein Wort mit mir wechseln. Es kam auch mal vor, dass ein Kleinkind anfing zu heulen, als es mich sah. Was anfangs noch ein Problem war, das mir wirklich zu schaffen gab, war die Tatsache, dass immer wieder Leute auf mich zukamen und Geld von mir wollten, weil weiß sein bedeutet reich sein. Da kam ich dann schon in manchen Gewissenskonflikt, weil ich ja mit eigenen Augen sah, wie arm die Leute doch waren. Hätte ich aber angefangen mit Geld austeilen, wäre am Ende jeder vor meiner Tür gestanden.
Auch jetzt im Nachhinein frag ich mich, wie man den Leuten dort unten am sinnvollsten helfen kann, nachhaltig und dass sie ihre Eigenständigkeit bewahren.
Doch mit der Zeit gewöhnten sich die Leute an die Tatsache, dass da eine Weiße unter ihnen wohnte. Wenn ich durchs Dorf lief, rief man mich nicht mehr mit Mzungu an sondern entweder mwalimu (Lehrer), wegen meiner Arbeit im Kindergarten, oder Miriamu. Sie bezeichneten mich als eine der Ihrigen, als Einheimische. Was mich natürlich schon mit Stolz erfüllte.
Wenn ich dann aber andere Dörfer besuchte, wo sie mich nicht kannten, war besonders die Reaktion der Kinder immer wieder erheiternd. Entweder sie standen nur entgeistert am Straßenrand und riefen "ah, mama, mzungu!" oder sie liefen mir nach und so hatte ich dann schon mal eine Traube von 40 Kindern hinter mir.
Alles in allem kann ich nur jedem solch eine Erfahrung ans Herz legen. Dieses Jahr bleibt für mich unvergesslich, auch wenn es zwischendrin wirklich schwierig war und ich dachte, wann ist es endlich vorbei, ging es im Endeffekt doch rasend schnell und ich wäre auch noch länger geblieben. Am letzten Tag gab es noch ein Abschiedsfest für mich und Tränen auf beiden Seiten. |